Um zu verstehen, wie unser Gehirn Einflüsse aus der Umwelt verarbeitet, hat man bislang im Labor einzelne geistige Funktionen untersucht. Das Problem: Laborexperimente haben manchmal wenig mit dem echten Leben zu tun, weil sie die Welt künstlich vereinfachen. Abhilfe könnte die virtuelle Realität schaffen. Mit ihr lässt sich unser Verhalten unter Alltagsbedingungen erforschen.
Wollen wir auf dem Weg zum Bäcker eine belebte Straßenkreuzung überqueren, muss unser Gehirn mit vielen Eindrücken fertig werden: Autos bewegen sich aus vier Richtungen aufeinander zu, ein Fahrradfahrer klingelt und wir riechen Abgase, während wir überlegen, ob wir nun diese oder die nächste Abzweigung nehmen sollten. Wie schafft es unser Gehirn all diese Reize zu verarbeiten, sodass wir den schnellsten Weg an unser Ziel finden können? In klassischen Laborstudien versucht man einzelne geistige Funktionen zu erforschen, indem man sie in stark vereinfachten Situationen untersucht. Seit einigen Jahren gibt es jedoch eine Technologie, durch die sich Alltagsszenen sehr lebensnah nachahmen lassen: Die virtuelle Realität. In der Forschung nutzen wir sie zum Beispiel, um zu verstehen, wie das Gehirn mentale Landkarten bildet, sodass wir uns merken können, wo unser Ziel liegt und wie wir dorthin finden.
Eine Szene wie die an der Straßenkreuzung kann man mittels virtueller Realität im Labor nachstellen. Obwohl die Situation für die Studienteilnehmerin aus dem Leben gegriffen scheint, können Wissenschaftler genau beeinflussen, was sie erlebt. In der virtuellen Welt kann immer die gleiche Tageszeit herrschen, es kann gleich viel Verkehr auf den Straßen sein oder plötzlich die gleiche Baustelle den Weg zum Ziel versperren, sodass ein Umweg gefunden werden muss. Gezielt verändern Forschende in Experimenten bestimmte Aspekte der Situation, um zu verstehen, wie diese sich auf unsere Wahrnehmung, unser Denken und unser Handeln auswirken. Die virtueller Realität kombiniert genaue Kontrolle über den Ablauf der Ereignisse für die Wissenschaftler mit einer reichen Erfahrungswelt für die Teilnehmer.
Technologische Fortschritte lassen virtuelle Welten dabei immer realistischer erscheinen. Viele kennen heute bereits Virtual-Reality-Brillen. Dieser Geräte zeigen unseren Augen zwei leicht versetzte Bilder, auf die wir durch Linsen schauen. So entsteht der Eindruck räumlicher Tiefe und das Gefühl, dass wir uns im virtuellen Raum befinden. Sensoren messen die Bewegungen und Drehungen unseres Kopfes. Dies wird genutzt, um die Bilder anzupassen, die der Versuchsteilnehmer vor sich sieht. Wie in der echten Welt ändert sich so, was wir sehen, wenn wir den Kopf drehen. Zusätzlich spielen Kopfhörer Töne ab – zum Beispiel das Hupen des Autos an der Kreuzung. Weil die Virtual-Reality-Brille verschiedene Sinne anspricht, tauchen wir tief in die virtuelle Welt ein und verhalten uns als wäre sie real.
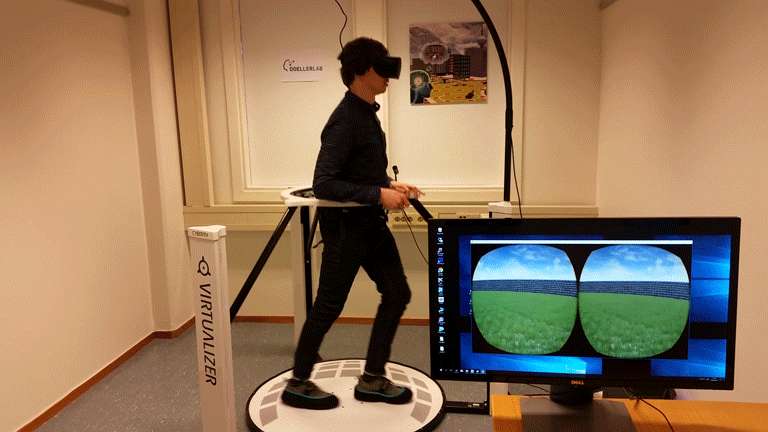
Um einen virtuellen Großstadtdschungel zu durchqueren, müssen wir uns fortbewegen. Zum Beispiel können zusätzliche Sensoren unsere Position im Zimmer erfassen. Doch dies beschränkt den Bereich, in dem wir uns bewegen können, auf die Dimensionen des Raumes, in dem wir uns befinden. Haben wir nicht gerade eine leere Turnhalle zur Verfügung, laufen wir Gefahr durch Zusammenstöße mit Wänden oder Möbelstücken schmerzhaft aus der virtuellen Welt gerissen zu werden. Neuartige Geräte versprechen einen anderen Ausweg: Auf sogenannten Bewegungsplattformen schieben wir unsere Füße über eine glatte Oberfläche. Diese Bewegung gleicht ein wenig Michael Jackson’s Moonwalk. Eingearbeitete Sensoren übersetzen die Schritte in virtuelle Bewegung (siehe GIF). Während wir so auf der Stelle treten, sind unseren virtuellen Streifzügen keine Grenzen mehr gesetzt.
In unserer Forschungsgruppe am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leizpig untersuchen wir mit Hilfe der virtuellen Realität, wie wir geistige Landkarten erstellen und uns so zum Beispiel Positionen im Raum einprägen. Wie können wir uns merken, wo es das beste Eis gibt und wie weit es von dort zum Schwimmbad ist? In einer aktuellen Studie testeten wir das räumlichen Gedächtnis unter Normalbedingungen und in einer Situation, in der das Koordinatensystem unserer geistigen Landkarten durch die besondere Form der virtuellen Umgebung gestört wurde. Wir beobachteten Verzerrungen des räumlichen Gedächtnisses, die den Vorhersagen, die wir mit einem Modell der Funktionsweise der mentalen Landkarten gemacht hatten, entsprachen (wer sich für die Details interessiert, findet hier eine Zusammenfassung der Studie).
In der virtuellen Realität kann auch Unmögliches möglich werden. So können wir in kreativen Experimenten Fragen angehen, die wir bisher nicht beantworten konnten. In einer Studie stellten wir beispielsweise in einer virtuellen Stadt Teleporter auf, die einen an einen anderen Ort „beamen“ konnten. Mit Eintritt in den Teleporter verschwindet die Person und taucht von einer Sekunde zur nächsten in einem völlig anderen Teil der Stadt wieder auf. Wir nutzten dies, um herauszufinden, wie wir unsere mentalen Landkarten aufbauen. In der echten Welt brauchen wir mehr Zeit, um größere Entfernungen zwischen zwei Orten zu bewältigen. Mit den Teleportern konnten unsere Studienteilnehmer jedoch ohne Verzögerung weit entfernte Orte erreichen. So trennten wir im Experiment die räumlichen und zeitlichen Beziehungen von Orten in der virtuellen Stadt. Wir beobachteten, dass die Zeit, die zwischen dem Besuch zweier Orte verstreicht, die mentalen Landkarten in einer für unser Gedächtnis wichtigen Hirnregion besonders beeinflusst (eine genauere Beschreibung gibt es hier).
Noch ist es eine große Herausforderung die Aktivität des Gehirns zu messen, während sich eine Studienteilnehmerin durch eine virtuelle Welt bewegt. Der Grund: Im Hirnscanner muss man möglichst regungslos liegen. Daher ist es schwierig, darin Virtual-Reality-Brillen zu nutzen. Als Alternative untersucht man bislang das Gehirn von Menschen bevor und nachdem sie eine virtuelle Stadt entdeckt haben. Die Wissenschaftler können so Veränderungen in der Hirnaktivität erkennen, die auf die neu geformten mentalen Landkarten zurückgehen. Mit neuer Technologie könnte es außerdem bald möglich sein, die Hirnaktivität auch dann zu messen, während jemand eine Virtual-Reality-Brille trägt und auf einer Bewegungsplattform eine virtuelle Welt erkundet.
Quelle:
Erkunden einer virtuellen Welt.
Foto von Stella Jacob via Unsplash


